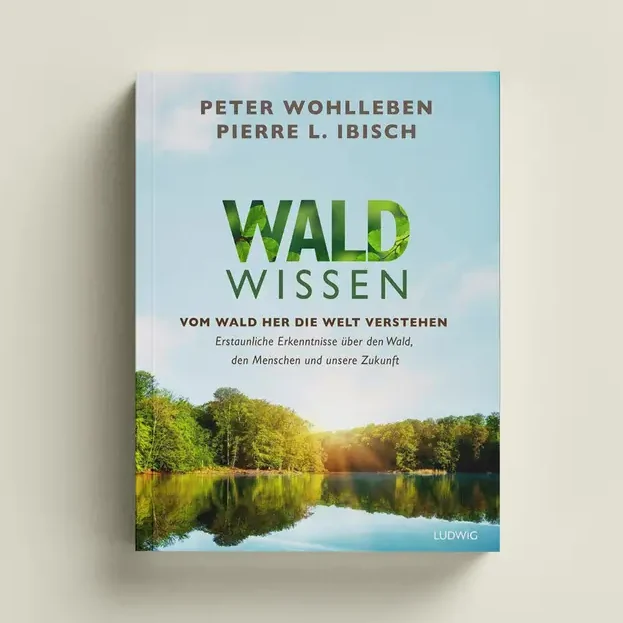
Waldwissen
»Wir haben dieses Buch geschrieben, weil wir den Wald lieben—und weil wir uns Sorgen um ihn machen. Ein Leben ohne Bäume, ohne Vögel unter dem raschelnden Blätterdach alter Buchen, ohne moosbewachsene Stämme, ohne Pilze im modrigen Totholz, ohne die würzige Luft an warmen Sommertagen oder ohne knarzendes Holz, wenn der Wind durch den Wald fegt, ist für uns nicht vorstellbar. Deswegen möchten wir alles versuchen, diesen Quell des Lebens und der Freude für uns alle zu erhalten.«
»Der Wald ist primär für sich selber da« sagt Autor Peter Wohlleben. Auf der Leipziger Buchmesse 2023 spircht Ulrich Timm mit dem Förster und dem Biologen und Co-Autor Prof. Pierre Ibisch über ihr neues Buch Waldwissen, über die Ursachen der Waldmisere, über Lösungen und eine neue forstwissenschaftliche Ausbildung.
Die 20 Prinzipien der sozialökologischen Waldbewirtschaftung
Zusammenfassend kann die sozialökologische Waldbewirtschaftung durch Prinzipien charakterisiert werden, die sich erstens aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und zweitens aus deren ethischen Reflexionen ergeben. Grundsätzlich ruht der Ansatz auf zwei Säulen, die wie Bedingungen formuliert werden können: Die Waldbewirtschaftung muss im Einklang mit dem Funktionieren von Ökosystemen erfolgen, und sie muss ethisch reflektiert sein, also immer wieder neu hinterfragen und zur Diskussion stellen, was sie überhaupt erreichen soll und was eine gute Bewirtschaftung bedeutet.
»Waldbewirtschaftung ist ökosystembasiert«
01
Wald muss als Bioreaktor verstanden werden
Wälder sind offene, energiewandelnde Systeme und unterliegen den Gesetzen der Thermodynamik.
02
Wald arbeitet mit Rücklagen, und wir müssen ihm dabei helfen
Wald investiert in seine Arbeitsfähigkeit. Wenn Ökosysteme zusätzliche freie Energie erhalten, wird jeglicher Überschuss, der nicht zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen benötigt wird, genutzt, um dissipative Strukturen zu bilden, die Energie aufnehmen und verwerten, sowie das System weiter vom thermodynamischen Equilibrium zu entfernen.
03
Wald muss quantitativ und qualitativ wachsen und lernen können
Die Grundlage für die ökosystemare Funktion, das System möglichst vom thermodynamischen Gleichgewicht—einfach gesagt: vom Chaos—fernzuhalten, sind drei Formen der Reifung:
- Wachstum der Biomasse
- Wachstum des Netzwerks
- Wachstum der Information
04
Wälder bewirtschaften heißt mit Wasser haushalten
Da Leben auf der Grundlage wässriger Lösungen funktioniert, sind Ökosysteme offene ökohydrologische Systeme. Die Kapazität von Wäldern, mit Wasser zu haushalten, nimmt auf allen Systemebenen einen entscheidenden Einfluss auf ihren Energiehaushalt und ihre Entwicklung.
05
Wälder und ihre Komponenten können nur funktionieren, wenn sie miteinander in Verbindung treten können
Die Reifung von Ökosystemen benötigt zeitliche sowie räumliche Kontinuität und eine entsprechende Verbundenheit (Konnektivität).
06
Ökosysteme sind nicht hierarchisch, deswegen sollte man ihnen auch keine Befehle erteilen
Wälder sind verschachtelte (genestete) Systeme, die zusammen mit anderen Systemen das globale Ökosystem bilden. Dieses größere Ganze wirkt auf die Teile, wie auch die Komponenten zurück auf das größere Gefüge wirken, von dem sie ein Bestandteil sind (Holarchie). Durch alle Wechselwirkungen, von oben nach unten und zurück, entstehen Funktionen und Regulierung.
07
In Ökosystemen ist (fast) alles möglich, ihre Entwicklung ist deshalb unvorhersehbar
Die Komplexität der Ökosysteme führt zusammen mit den thermodynamisch bedingten Eigenschaften wie Unumkehrbarkeit und Instabilität zu einer Entwicklungsoffenheit des Systems und damit zu einer ihnen innewohnenden Unbestimmtheit.
08
Wälder bilden Puffer und Kreisläufe aus und werden damit effizienter
Wachstum und Entwicklung reifender Ökosysteme stehen im Zusammenhang mit der Zunahme von Kreisläufen. Vor allem Wasser und Nährstoffe werden recycelt, was Wälder etwas unabhängiger von der Umwelt macht.
09
In Ökosystemen befeuern sich Ursachen und Wirkungen gegenseitig, was wesentlich zu Steuerung und Entwicklung beiträgt
Aus »viel« kann schnell »noch mehr« werden—oder auch »viel weniger«. Positive und negative systemische Rückkopplungen sind eine wesentliche Grundlage der Regulation sowie der Anpassungsfähigkeit in Ökosystemen.
10
Ökosysteme entwickeln sich durch die fortwährende Zerstörung und Neuorganisation von Systemkomponenten
Adaptive Zyklen, die auf den verschiedenen ineinander verschachtelten Systemebenen existieren und zusammen wirksam werden, sind eine Grundlage der Anpassungs- und Erholungsfähigkeit (adaptive Resilienz) eines Ökosystems. Die »schöpferische Zerstörung« ist ein wichtiges Element der Funktionstüchtigkeit.
»Waldbewirtschaftung ist ethisch reflektiert und leistet einen Beitrag zum kurz- und langfristigen Wohlergehen der Menschen.«
11
Die Nutzung oder Bewirtschaftung von Wäldern soll nicht ohne ethische Reflexion erfolgen
Die sozialökologische Waldbewirtschaftung ist in einem ökohumanistischen Sinne ökosystembasiert und menschenzentriert. Das bedeutet, dass zu dem naturwissenschaftlich beschreibbaren Fundament der Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen eine relevante ethische Reflexion und Orientierung tritt, um angemessene Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung aller Ressourcen zu schaffen.
12
Im Umgang mit Wald wird immer der Tatsache Rechnung getragen, dass wir ihn nicht nur rational nutzen, sondern auch emotional erleben und benötigen
Die emotionale Ebene unseres Erlebens und Entscheidens sowie unsere Befähigung zur Biophilie und der Empathie mit dem Wald und seinen Lebewesen verdient Anerkennung und Förderung.
13
Jegliche Waldbewirtschaftung muss im Interesse der Menschen für den Wald und auch direkt für Menschen gut sein
Die Waldbewirtschaftung erfolgt einzig mit dem Ziel, zu einem guten Leben von Menschen beizutragen, der Wald benötigt sie nicht. Sie fördert diejenigen Ökosystemfunktionen, die wir als Ökosystemleistungen bezeichnen, weil sie direkt oder indirekt zum menschlichen Wohlergehen beitragen. Es muss in der Waldbewirtschaftung gerade wegen dieses letztendlichen Zieles eines guten Lebens von Menschen ein ökologisches Primat gelten.
14
Es ist für zeitgemäße Waldgerechtigkeit zu sorgen
Eine sozialökologische Wald-Governance zielt auf ein angemessenes gesellschaftliches Abwägen bei der Bewertung, Förderung, Nutzung beziehungsweise Zugänglichmachung sämtlicher Ökosystemleistungen ab.
15
Zu einer ordentlichen wirtschaftlichen Gesamtrechnung der Waldbewirtschaftung gehören alle Einnahmen und alle Kosten
Eine sozialökologische Waldbewirtschaftung steht für eine transparente und möglichst vollständige ökonomische Gesamtrechnung. Das heißt, es wird nicht nur die Wertschöpfung betrachtet—in Geld bewertbar oder nicht—, sondern darüber hinaus auch die »Schadschöpfung«. Es darf keine verborgene Auslagerung (Externalisierung) von Kosten geben.
16
Die sozialökologische Waldbewirtschaftung trägt zum Verständnis eines ökologischen Modells der wirtschaftlichen Entwicklung bei, die ohne quantitatives Wachstum auskommt
Ein gutes Leben der Menschen kann nur innerhalb der von der Tragfähigkeit der Ökosysteme vorgegebenen Grenzen erreicht werden. Ob ein Ökosystem funktioniert und wie viele Menschen es (er)tragen kann, ist dabei nicht für alle Zeit fest definiert. Das kann sich sehr schnell wandeln, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern.
17
Ein gutes Leben der Menschen kann nur innerhalb der von der Tragfähigkeit der Ökosysteme vorgegebenen Grenzen erreicht werden. Ob ein Ökosystem funktioniert und wie viele Menschen es (er)tragen kann, ist dabei nicht für alle Zeit fest definiert. Das kann sich sehr schnell wandeln, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern.
Es geht bei der Bewirtschaftung nicht um einen Minimalkonsens und Konfliktlösung um der Harmonie willen. Die aktuelle Lage der Wälder bedarf einer konstruktiven Auseinandersetzung auf dem bestmöglichen fachlichen Niveau.
18
Der Umgang mit Wissen ist post-normal, was unter anderem bedeutet, dass wissenschaftliches Wissen nicht exklusiv sein darf und dass alle Formen relevanten Wissens in den Lernprozess einbezogen werden
Es gilt, den Respekt vor dem anderen Wissen zu trainieren, es angemessen in die Arbeit zu integrieren und Arbeiten mit dem Wald immer auch als gemeinsame Wissensproduktion zu verstehen.
19
In der sozialökologischen Waldbewirtschaftung geht es nicht darum, vorhandenes Wissen leichtfertig in Handlungen zu überführen, sondern vielmehr vor allem auch darum, das identifizierte oder geahnte Nichtwissen zu nutzen und alle Handelnden zu Vorsicht anzuhalten
Im Umgang mit dem Wald und mit unserem Wissen über ihn und die Folgewirkungen unserer Handlungen ist Demut ein Leitmotiv. Verunsicherung wird als Bestandteil des Lernprozesses angenommen, von Gewissheit wird abgesehen. Der bewusste und aktive Umgang mit den Grenzen der Erkenntnis und dem Nichtwissen ist Teil des akademischen Fundaments der sozialökologischen Waldbewirtschaftung. Es geht in keinem Falle um eine Wissensfeindlichkeit, ganz im Gegenteil: Fakten und Evidenz werden wertgeschätzt und in ihrem Zusammenhang reflektiert.
20
In der sozialökologischen Waldbewirtschaftung ist ein reflektiertes adaptives Management die Grundlage für die Entwicklung von Strategien
Dabei wird das Handeln nicht allein an Visionen orientiert, sondern als Teil eines Lernprozesses verstanden. Es werden genügend Ressourcen für Dokumentation und kritische Überprüfung bereitgestellt. Der Ansatz ist fehlerfreundlich, versucht aber gleichzeitig, bestmöglich aus Fehlern zu lernen.
Podcast von Peter Wohlleben
Im Jahresrückblick sprechen Peter und Professor Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) über die »Highlights« und »Lowlights« des letzten Jahres: Was lief gut, was lief schlecht für den Wald in 2024 – und warum eigentlich? Es geht unter anderem um Lobbyismus, Bundeswaldinventur, Wahlen und die Entstehung des neuen Studiengangs »Sozialökologisches Waldmanagement«. Außerdem erklärt Peter, warum es 2025 trotz ökologischer Probleme weiterhin Grund zum Optimismus gibt.
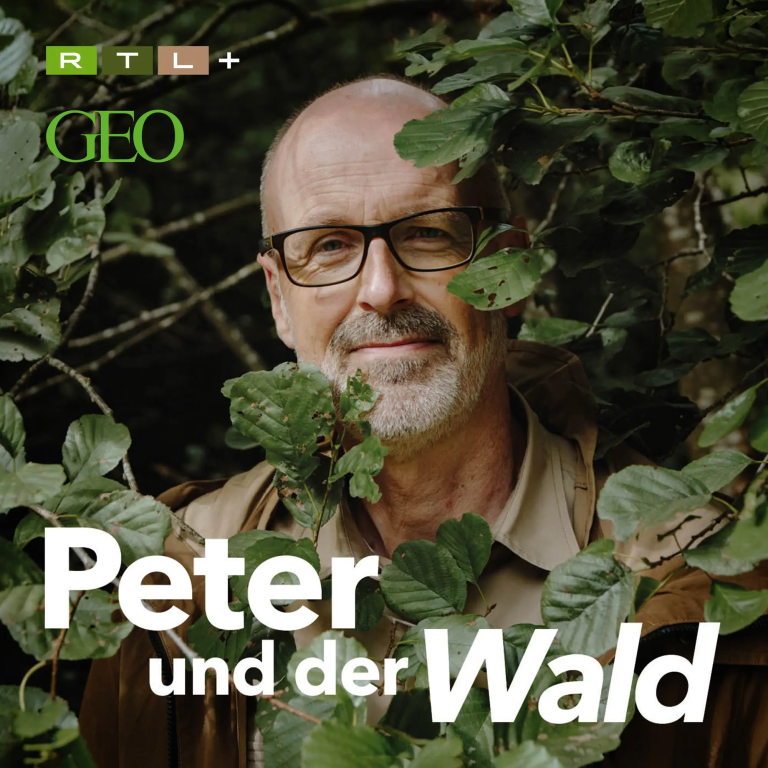
Dem Wald geht es schlecht und schlechter – und damit steht mehr auf dem Spiel, als manche wissen. Der grüne Europa-Abgeordnete Martin Häusling lud im November 2024 fast 200 Wissenschaftler:innen, Praktiker:innen, Waldbesitzer:innen und Gäste aus ganz Deutschland zum dritten Mal zur Waldtagung ein, um zu diskutierten, was zur Rettung des Waldes getan werden kann und muss.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.
